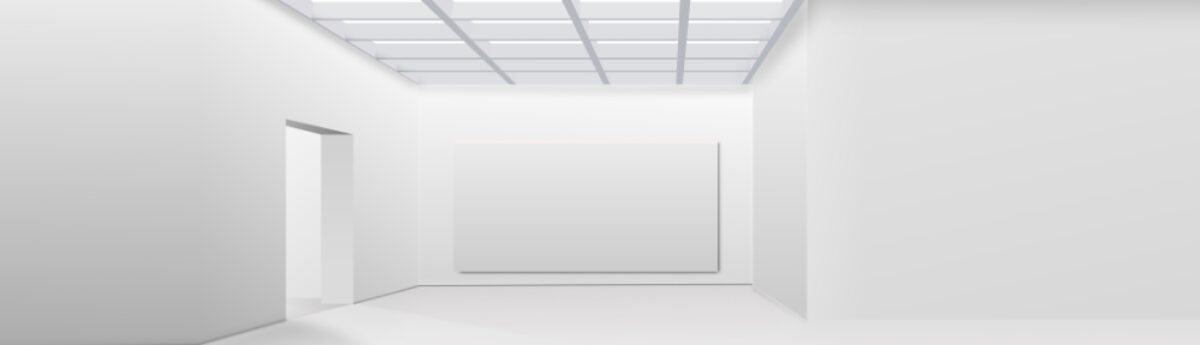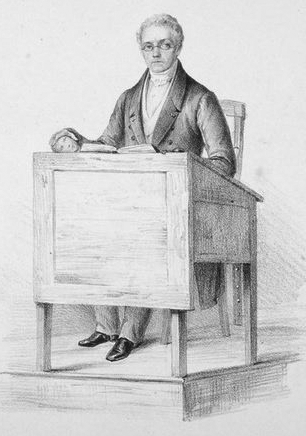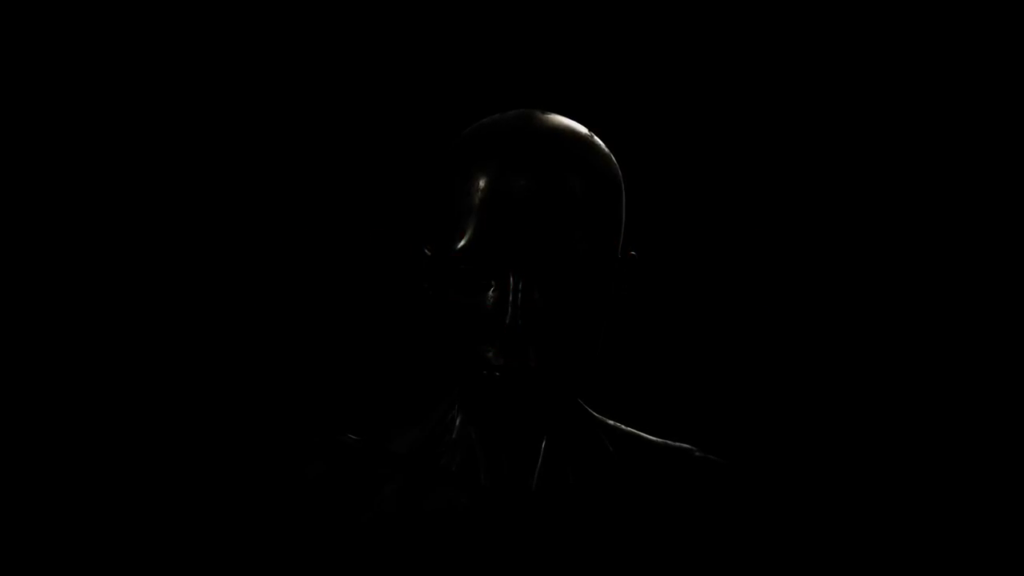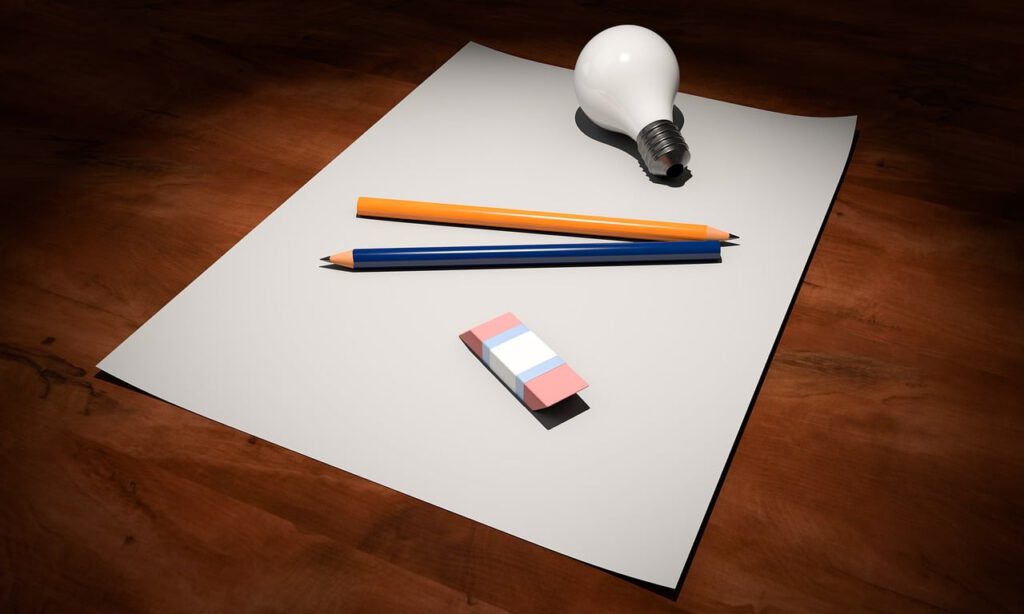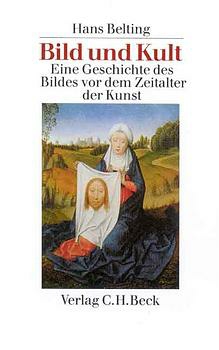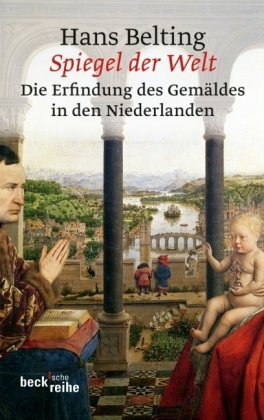Claudia Roth war als Ehrengast zur Jewrovision vom Zentralrat der Juden eingeladen und wurde dann während ihrer Rede von den Teilnehmer:innen ausgebuht. Man muss schon ein merkwürdiges Verständnis von Gastfreundschaft haben, wenn man jemanden so behandelt: ihn als Ehrengast einzuladen und ihn dann auszubuhen. Nun kann man zu Claudia Roth stehen, wie man will, ich persönlich sehe vieles kritisch, was sie macht, aber so verhält man sich nicht.
Worum es aber im Kern geht, sind nicht Stilfragen, sondern Kernfragen der Kulturpolitik und des Staatsverständnisses. Und da habe ich große Probleme, welches Staats- und Kulturpolitikverständnis der Zentralrat der Juden artikuliert. Es geht darum, dass der Staat der Kunst und Kultur vorgeordnet werden soll. Gegen zentrale Bestimmungen unseres Grundgesetzes soll der Staat entscheiden, ob bestimmt Kunstwerke zugelassen oder entfernt werden oder Kulturveranstaltungen zugelassen werden. Dieses Verständnis ist verfassungsfeindlich – um es klar und deutlich zu sagen. Der Staat, das ist eine Lehre aus der schrecklichen Kulturpolitik des Dritten Reiches, hat sich aus der Kunst herauszuhalten. Er reguliert nicht die Kunst danach, welche politischen, sozialen oder religiösen Haltungen die Kunstproduzierenden haben. Er betreibt mit anderen Worten keine Gesinnungsschnüffelei.
Genau das fordern aber jene, die sagen, dass wer bestimmte Haltungen vertritt – etwa eine gewisse Nähe zur BDS-Bewegung erkennen lässt -, keine Auftritte mehr in Deutschland haben solle. Und es geht dabei nicht nur um öffentlich geförderte Veranstaltungen, sondern – wie das Beispiel von Roger Waters zeigt – um jede Form von öffentlichen Auftritten. Das ist umso merkwürdiger, als dass sehr feine Unterscheidungen gemacht werden, wann man auf die BDS-Nähe von Künstlern hinweist. Wenn es einem passt, lässt man den Hinweis auch schon einmal weg, in anderen Fällen wird er mühsam konstruiert – er/sie kennt jemanden, der BDS unterstützt. So sollten wir nicht mehr über Kulturpolitik reden. Die Lehre, den die Väter der Verfassung gezogen haben, war die Feststellung, dass die Kunst in Deutschland frei ist. Das heißt nicht, dass sie alles machen kann, sie unterliegt wie jeder andere den Gesetzen der Bundesrepublik, aber es gibt keine kulturpolitischen Vorgaben im Blick auf die Haltungen der Künstler:innen. Genau das wird im Moment aber gefordert und wer sich dem nicht beugt, wird ausgebuht. Im Augenblick haben fast alle Gerichte und Staatsanwaltschaften der vorsichtigen Position gegenüber einer Ausgrenzung von Künstler:innen aufgrund bestimmter Haltungen aus verfassungsrechtlichen Gründen den Vorzug gegeben. Und die Verfassung ist an diesem Punkt auch nicht einfach änderbar, es gehört zu den Grundrechten. Der Kulturstaatsministerin ist bei der Bewertung von Haltungen von Künstler:innen äußerste Zurückhaltung angeraten. Es kommt dem Staat schlicht nicht zu.
Der Zentralrat der Juden möchte nun eine Art Vorinstanz etablieren, die zunächst prüft, welche Haltung Künstler:innen z.B. im Blick auf Israel oder zur Bewegung BDS haben und dann erst die Entscheidung trifft, aber diese Künstler:innen auftreten dürfen. So etwas ist gängige Praxis in beinahe allen totalitären und islamistischen Systemen dieser Welt. Es sollte nicht die Praxis der BRD werden. Ich möchte weder, dass die Deutsche Bischofskonferenz, noch der Rat der EKD, noch der Zentralrat der Muslime und auch nicht der Zentralrat der Juden irgendein formales Recht haben, Kulturveranstaltungen zu verhindern. Das wäre ein Rückfall in vordemokratische Zeiten. Dort, wo tatsächlich Christen, Muslime oder Juden beleidigt werden, wo Volksverhetzung betrieben wird, muss der Rechtsweg eingehalten werden. Aber das ist nicht gewünscht, wohl wissend, dass wir in einem liberalen Rechtsstaat leben, in dem die Gerichte den Zensurvorhaben Schranken setzen. Deshalb versuchen einige, illiberale Abkürzungen zu etablieren – an der Verfassung vorbei auf Kunst und Kultur Zugriff zu nehmen.
Es ist nun gut, dass fünfzig Persönlichkeiten aus der jüdischen Community erklärt haben, dies geschehe nicht in ihrem Namen. Zu den 50 Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern des offenen Briefes zählen etwa Daniel Barenboim, Daniel Cohn-Bendit, Daniel Kahn, Barrie Kosky, Igor Levit, Rachel Libeskind, Meron Mendel, Eva Menasse, Jerry Merose, Jerzy Montag, Michael Naumann, Susan Neiman, Miriam Rürup, Sasha Marianna Salzmann, Julius Schoeps, Paula-Irene Villa Braslavsky, Albert Wiederspiel, Mirjam Zadoff oder Moshe Zimmermann. Das ist eine sehr wichtige Intervention und sie kann nicht einfach als Einzelmeinung beiseite gewischt werden. Die Verfasser erklären „Roth habe die schwere Aufgabe, in diesem Spannungsfeld die demokratischen Normen und die Freiheit der Kunst im Auge zu behalten, weil Kunst zwar politisch ist, aber politische Eingriffe in die Kunst unterbleiben müssen. Kulturschaffende bräuchten eine politische Umgebung, in der sie ungehindert arbeiten könnten. Viele Juden gestalten in Deutschland den Kulturbetrieb mit – es muss liberaler Konsens bleiben, dass Religionsgemeinschaften keinen Einfluss darauf nehmen.“