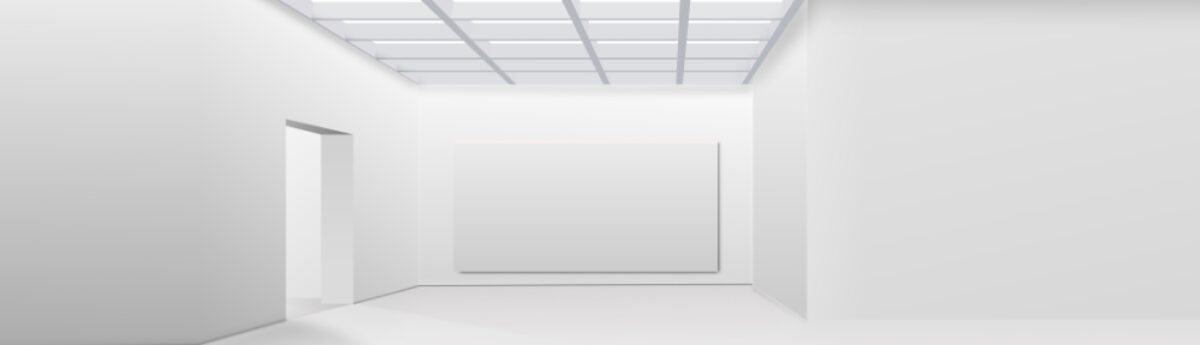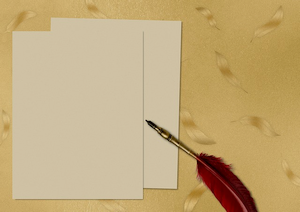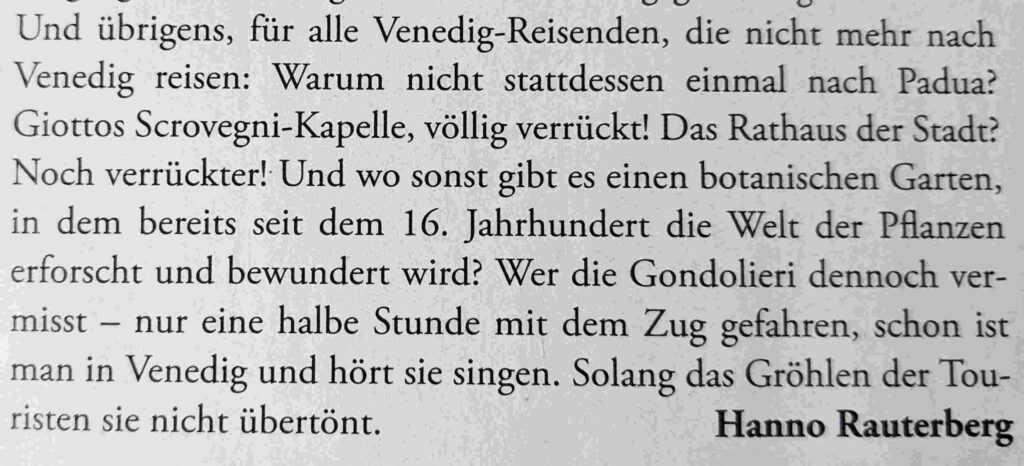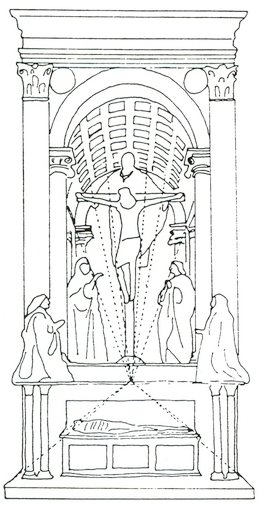
PERSPEKTIVE(N)
Wie Gott verortet wurde
Was die Perspektive in der Kunst bewirkte –
theologisch und politisch
Andreas Mertin [24 S.]
Aus der Perspektive des 16. Jahrhunderts
Giorgio Vasari über Masaccio [6 S.]
Aufstieg – Verführbarkeit durch Macht – Abstieg – Fall
Ein essayistisches Zwiegespräch mit ChatGPT über
Charles Mingus ‘Pithecanthropus Erectus’
Andreas Mertin [26 S.]
Von Imagination und Wissen, Politik und Kunst,
Realismus und Sehnsucht
Oder Glaube und Frieden in Songs
von John Lennon und Bob Dylan
Matthias Surall [16 S.]
Herrschaft in Sepia
Was Wandbilder über die Machtphantasien von AfD-Politikern verraten
Karin Wendt [18 S.]
Odd one out
Bloß ein Party-Spiel oder doch ein partei-politisches Spiel?
Andreas Mertin [6 S.]
VORMERKUNGEN
Büchertürme und ein alter Mann
Vormerkungen (Folge 12): Über eine Werbeanzeige
aus der Kampagne des Modeschöpfers Brunello Cucinelli
Wolfgang Vögele [4 S.]
Das Zwitschern der Meise
Vormerkungen (Folge 13): Über Jonathan Lear, Radikale Hoffnung
Wolfgang Vögele [4 S.]
SCHÖNHEIT
Wenn das Hässliche schön wird
Der revolutionäre Beitrag des Christentums zur Debatte um die Schönheit
Andreas Mertin [16 S.]
„Herr Doktor, das ist schön von euch“
Ein Widerspruch gegen die unkritische Verklärung des Schönen
Andreas Mertin [34 S.]
JURY FILM DES MONATS
Nachgedanken
Zum Umgang mit der Jury des Films des Monats
Andreas Mertin [10 S.]
Alternativer Film des Monats: Ruth und Boaz
Ausgewählt und vorgestellt von ChatGPT
ChatGPT [6 S.]
ANDREAS MERTINS KRITISCHE MISZELLEN
Fremd im eigenem Land?
Vom Alltagsrassismus [6 S.]
Warum man mit Märchen Trump besser versteht
Und auf einen guten Ausgang hoffen kann: Vom Fischer und seiner Frau [6 S.]