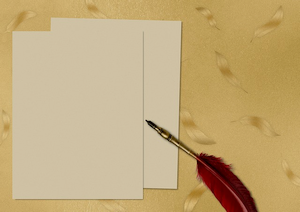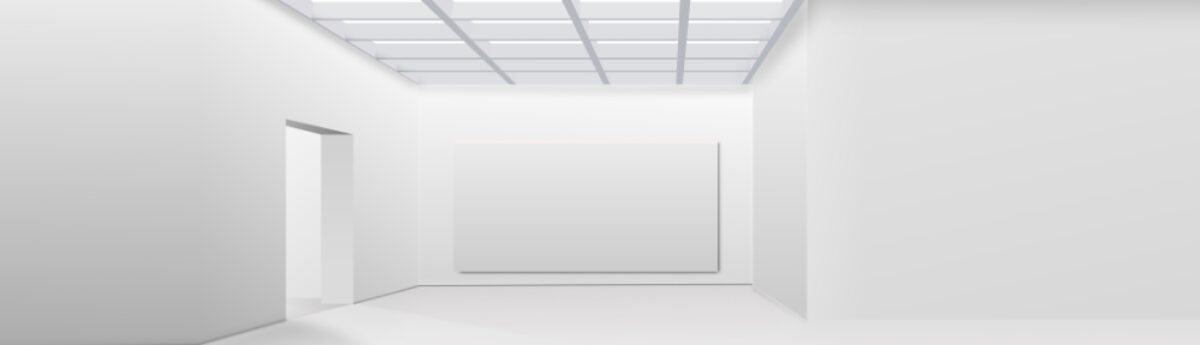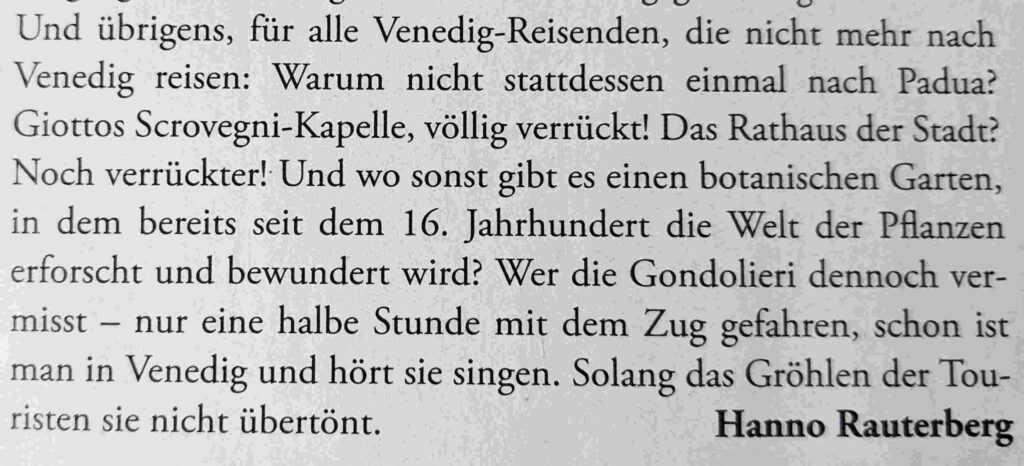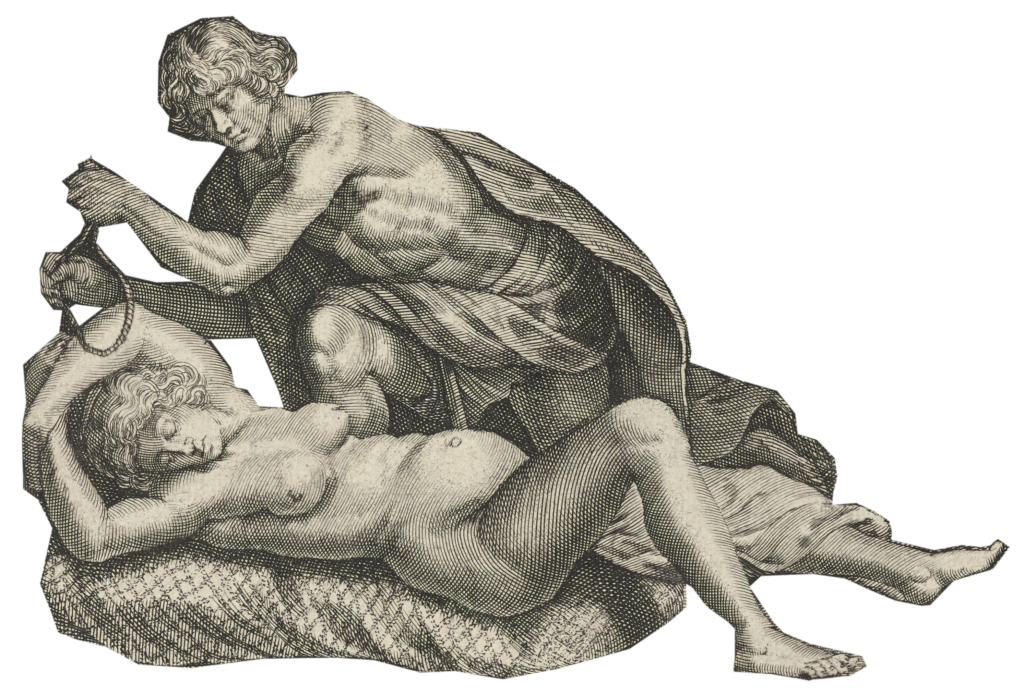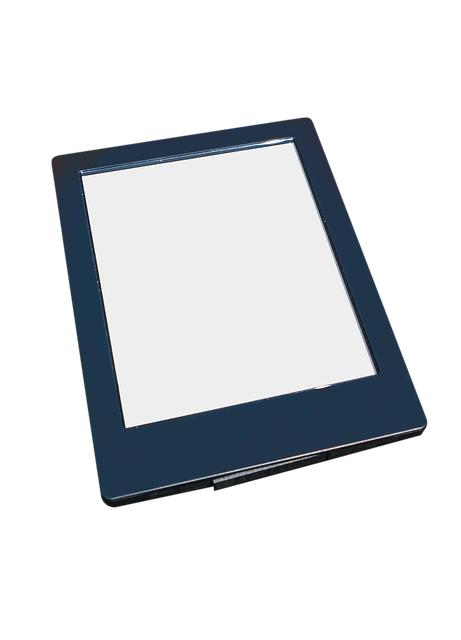Man ist doch immer wieder überrascht, wie weit entwickelt die Widerstandsbewegung in den USA ist und wie verkümmert sie bei uns in Deutschland ist. Bei uns reicht es, wenn 100.000 auf die Straße gehen, um gegen rechts protestieren, aber damit ist noch keinem der von den Rechten Bedrängten geholfen. Ganz anders und ganz pragmatisch geht dagegen der frühere Arbeitsminister der USA, Robert Reich, vor, der auf seiner Website „Zehn Wege, Trump zu widerstehen“ veröffentlichte. Ich nenne sie in der Folge seine 10 Gebote, weil mir das theologisch naheliegender ist. Sein Eröffnungsbild ist die amerikanische Flagge, die aber wie Erdschollen in der Sonne unter der Hitze ausdunstet und zerbricht.
Robert Reichs erstes Gebot lautet: Schützen Sie die anständigen und hart arbeitenden Mitglie-der Ihrer Gemeinschaften, die keine Papiere besitzen oder deren Eltern keine Papiere besitzen. Das hört sich so selbstverständlich an, aber ist es ganz und gar nicht. In Deutschland unterstützt der allergrößte Teil der Gesellschaft die Abschiebung derer, die keine ausreichende Legitimation haben. Die Aufforderung, gerade sie zu schützen, ist daher etwas Besonderes.
Sein zweites Gebot lautet: Schützen Sie die LGBTQ+-Mitglieder Ihrer Gemeinschaft. Trump könnte das Leben für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, Queers und andere Menschen durch Durchführungsverordnungen, Gesetzesänderungen, Änderungen der Bürgerrechtsgesetze oder Änderungen bei der Durchsetzung solcher Gesetze erheblich erschweren. Noch(!) ist diese Gruppe in unserer Gesellschaft durch staatliche Maßnahmen nicht so gefährdet wie in den USA, aber es ist wichtig daran zu denken und darauf vorbereitet zu sein.
Sein drittes Gebot lautet: Helfen Sie mit, Beamte in Ihrer Gemeinde oder Ihrem Bundesstaat zu schützen, gegen die von Trump und seiner Regierung zur Rache angestiftet wird. Bei einigen handelt es sich vielleicht um Beamte der unteren Ebene, wie z. B. Wahlhelfer. Wenn sie nicht über die Mittel verfügen, sich rechtlich zu verteidigen, können Sie ihnen helfen oder eine Go-Fund-Me-Kampagne in Erwägung ziehen. Wenn Sie von jemandem hören, der ihnen schaden will, alarmieren Sie sofort die örtlichen Strafverfolgungsbehörden.
Sein viertes Gebot lautet: Beteiligen Sie sich oder organisieren Sie Boykotte von Unternehmen, die das Trump-Regime unterstützen, angefangen bei Elon Musks X und Tesla sowie allen Un-ternehmen, die bei X oder auf Fox News werben. Unterschätzen Sie nicht die Wirksamkeit von Verbraucherboykotten. Unternehmen investieren viel in ihre Markennamen und den damit verbundenen Goodwill. Laute, lautstarke, aufmerksamkeitsstarke Boykotte können den Marken-namen schaden und die Aktienkurse der Unternehmen senken. Das wäre ein höchst dringlicher programmatischer Ansatz in Deutschland, konkret gegen Diskriminierung vorzugehen.
Sein fünftes Gebot lautet: Unterstützen Sie im Rahmen Ihrer Möglichkeiten Gruppen, die gegen Trump prozessieren. In Deutschland wären das jene Gruppen, die gegen die AfD aufstehen und gegen sie prozessieren. Das zumindest erfüllen die Protestierenden auf unseren Straßen.
Sein sechstes Gebot lautet: Verbreiten Sie die Wahrheit. Besorgen Sie sich Nachrichten aus zuverlässigen Quellen und verbreiten Sie sie. Wenn Sie hören, dass jemand Lügen und Trump-Propaganda verbreitet, einschließlich lokaler Medien, widersprechen Sie ihm mit Fakten und den entsprechenden Quellen. Und dann nennt er eine Reihe von Quellen, denen er vertraut. Auch das wäre für Deutschland ein interessanter Punkt: welchen Medien können wir vertrauen?
Sein siebtes Gebot lautet: Fordern Sie Freunde, Verwandte und Bekannte auf, Trump-Propaganda-Sender wie Fox News, Newsmax, X und zunehmend auch Facebook und Instagram zu meiden. Sie sind voll von hasserfüllter Bigotterie und giftigen und gefährlichen Lügen. Manche Menschen können diese Propagandaquellen auch süchtig machen; helfen Sie den Men-schen, die Sie kennen, sich von ihnen zu entwöhnen. Gilt nicht nur in den USA, sondern überall.
Sein achtes Gebot lautet: Setzen Sie sich für fortschrittliche Maßnahmen in Ihrer Gemeinde und Ihrem Staat ein. Lokale und staatliche Regierungen haben nach wie vor große Macht. Schließen Sie sich Gruppen an, die Ihre Stadt oder Ihren Staat voranbringen, im Gegensatz zu den regressiven Maßnahmen auf Bundesebene. Betreiben Sie Lobbyarbeit, organisieren Sie und sammeln Sie Spenden für fortschrittliche Gesetzgeber. Unterstützen Sie progressive Politiker.
Sein neuntes Gebot lautet: Ermutigen Sie die Arbeiter zu Aktionen. Die meisten Gewerkschaf-ten stehen auf der richtigen Seite – sie wollen die Macht der Arbeitnehmer stärken und sich gegen Unterdrückung wehren. Sie können sie unterstützen, indem Sie sich an Streikpostenket-ten und Boykotten beteiligen und die Beschäftigten in den Betrieben, die Sie besuchen, ermuti-gen, sich zu organisieren. Auch das gilt weltweit.
Sein zehntes Gebot lautet: Behalte den Glauben. Geben Sie Amerika nicht auf. Denken Sie daran, dass Trump die Volksabstimmung mit nur 1,5 Punkten Vorsprung gewonnen hat. Nach al-len historischen Maßstäben war das eine knappe Angelegenheit. Im Repräsentantenhaus haben die Republikaner mit fünf Sitzen den geringsten Vorsprung seit der Großen Depression. Im Se-nat haben die Republikaner die Hälfte der für 2024 anstehenden Senatswahlen verloren, darunter in vier Staaten, die Trump gewonnen hat. Den Kampf optimistisch angehen: Wir schaffen das!
Und am Ende fügt Robert Reich hinzu: Achten Sie bitte darauf, dass in Ihrem Leben auch Platz für Freude, Spaß und Lachen ist. Lassen Sie sich nicht von Trump und seiner Finsternis vereinnahmen. Genauso wie es wichtig ist, den Kampf nicht aufzugeben, ist es von entscheidender Bedeutung, auf sich selbst aufzupassen. Wenn Sie von Trump besessen sind und in den Kaninchenbau der Empörung, Sorgen und Ängste abtauchen, werden Sie nicht in der Lage sein, weiter zu kämpfen. Mit Wolf Biermann gesungen:„Du lass Dich nicht verhärten in dieser harten Zeit, die allzu hart sind, brechen, die allzu spitz sind, stechen und brechen ab sogleich …“
Man müsste nun überlegen, was das Pendent dafür in unserer Gesellschaft wäre, was die EKD oder die DBK auf ihren Seiten programmatisch zu sagen hätte – nicht um Parteipolitik zu betreiben, sondern um die Gefährdeten und die Benachteiligten zu schützen und den Gläubigen klar zu machen, dass die Aufforderung zur Gnade, die die Bischöfin Budde an Donald Trump richtete, eben auch eine Aufforderung ist, die an jeden einzelnen Christen geht.