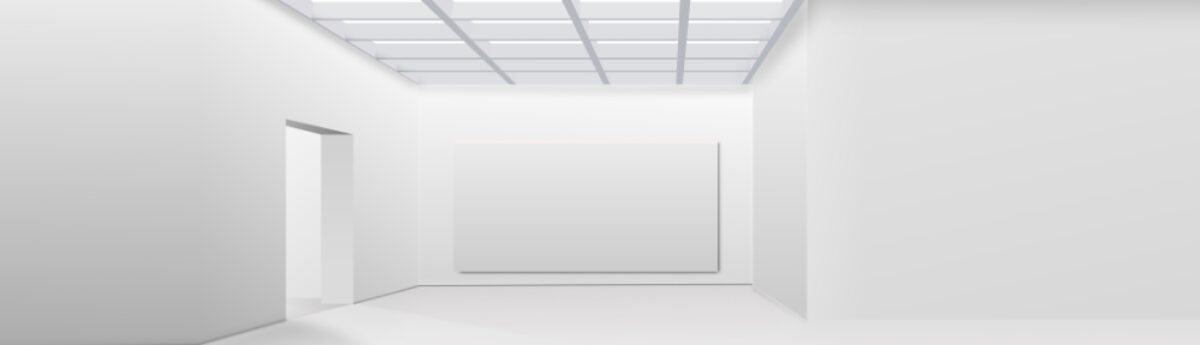https://eurovisionworld.com/eurovision/2024#switzerland
Der Eurovision Song Contest betont immer, er sei eine unpolitische Veranstaltung. Das muss er wohl auch, um nicht zur politischen Propaganda-Plattform zu werden. Dennoch ist er natürlich durch und durch politisch. Weniger in dem, was die Gruppen singen, sondern in dem, wie die Menschen europa- und inzwischen ja auch weltweit abstimmen. Das wurde dieses Mal besonders deutlich. Während alle auf die Schreihälse vor und in der Konzerthalle starrten, stimmte die europäische Bevölkerung ab – und das ziemlich eindeutig. Gehen wir einmal davon aus, dass der israelische Beitrag für alle erkennbar nicht der beste und auch nicht der zweit- oder drittbeste war, dann kann das Abstimmungsverhalten der europäischen Bevölkerung nur als eindrückliches kulturpolitisches Zeichen gelesen werden. Was immer Grata Thunberg und ihre propalästinensischen Mitstreiter:innen vorab und parallel agitiert haben, die europäische Bevölkerung, soweit sie überhaupt am ESC interessiert war, hat das nicht gekümmert. Sie wollten ein Zeichen der Solidarität mit Israel geben. Während die deutsche Publizistik und diverse Lobbyist:innen beredt über den grassierenden Antisemitismus klagten, griffen die Menschen in Europa zum Telefonhörer und setzten ein kulturpolitisches Zeichen.
- 15 nationale Televotings setzen Israel auf Platz 1
(Australien, Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, San Marino, Schweden, Schweiz, Spanien und der sog. Rest der Welt). - 7 nationale Televotings setzten Israel auf Platz 2
(Albanien, Irland, Moldavia, Österreich, Slowenien, Tschechien, Zypern). - 3 nationale Televotings setzten Israel auf Platz 3
(Dänemark, Georgien, Island) - 3 nationale Televotings setzten Israel auf Platz 4
(Aserbaidschan, Griechenland, Lettland).
Damit haben 28 von 37 nationalen Televotings Israel aus kulturpolitischen Gründen hervorgehoben (wenn man davon ausgeht, dass Platz 5 eine angemessene Wertung wäre). Das ist ein eindrucksvolles Zeichen der Solidarität. Und die, so vermute ich, bezog sich weniger auf den Nahost-Konflikt selbst, sondern vor allem auf die unangemessenen Versuche von Aktivist:innen, Israel und Jüd:innen aus der Kultur auszuschließen. Dagegen wollte man protestieren und ein Zeichen setzen. Die Solidarität, unter den Künstler:innen des ESC nicht wirklich funktionierte (das Verhalten Griechenlands und der Niederlande während der Pressekonferenz war unsäglich), wurde stattdessen von den Menschen in Europa durch ihre Abstimmungen zum Ausdruck gebracht. Dass Jury und Publikum aus der Ukraine und aus Kroatien jeweils 0 Punkte gaben, dürfte eher aus taktischen Gründen geschuldet sein, um einen Mitkonkurrenten zu begrenzen. Israel dagegen hat alle unmittelbaren Konkurrenten bedacht. Dass Israel bei seinem Voting die einzige weitere Jüdin im Wettbewerb bevorzugt (24 Punkte für Luxemburg), kann man nachvollziehen.
Was mir aber wichtig ist, dass den Menschen europaweit der Boykott-Aktivismus a la BDS und Thunberg zunehmend auf den Keks geht. Sie setzen der kulturpolitischen Ausgrenzung ein kulturpolitisches Zeichen entgegen. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn derartige Wettbewerbe ganz frei von solchen Auseinandersetzungen wären, aber seien wir ehrlich: Der ESC ist seit mehr als zwei Jahrzehnten ein kulturelles Kampffeld – für Diversität, Queerness, für ein liberales und offenes Europa. Jene aber, die Kultur als ein rein politisches und national-politisches Kampffeld begreifen, sind dieses Mal krachend gescheitert, kaum jemand in Europa wollte ihnen folgen, selbst in jenen Ländern nicht, wo die größten Communitys der Palästinenser in Europa sind: Frankreich (mehr als 100.000), Schweden (bis zu 75.000), Großbritannien und Deutschland (offiziell 8000, geschätzt 175.000 bis 225.000) gaben im Televoting jeweils 12 Punkte für Israel.
Wäre ich pro-palästinensischer Aktivist, würde mir das zu denken geben. Offenbar ist die aktuelle Form des Aktivismus völlig kontraproduktiv, es stärkt die Seite, die man doch kritisieren will. Ich vermute, dass sich auch jenseits der kulturpolitischen Kampffelder dieser Effekt einstellt, also etwa im Blick auf die Universitäten und andere gesellschaftliche Bereiche.
Für die pro-israelisch Engagierten gäbe es dagegen Anlass zu viel mehr Gelassenheit und Souveränität. Man agiert aus einer Situation, in der ein Großteil der europäischen Bevölkerung hinter einem steht und dort Zeichen setzt, wo die liberale Kultur bedroht ist. Das spricht dafür, weniger auf kulturpolitische Begrenzungen und Vorgaben zu setzen, sondern den Rezipient:innen in Europa zuzutrauen, selbst Stellung zu beziehen. Das ist immerhin ein ermutigendes Zeichen.
P.S. Wie ich gerade sehe, geht der Kommentar von Jan Feddersen in der taz in dieselbe Richtung: Volksabstimmung pro Israel.