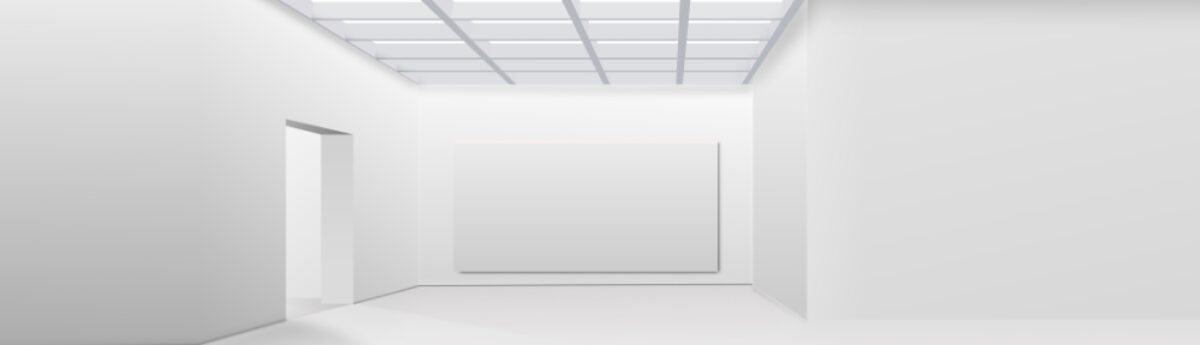Berthold Kohler, Herausgeber der FAZ, spielt Gott und weiß den russischen Söldnerführer bereits in der Hölle. So wünscht sich das Bürgertum die Welt und vor allem die Religion. Der liebe Gott – nein, der Mensch anstelle Gottes – soll es richten. Er sieht Prigoschin auf dem Weg in die Unterwelt, der er nach allem was wir wissen, doch niemals entsprungen war. Aber Kohler meint gar nicht die kriminelle Unterwelt oder das Reich des Todes, sondern er meint die Hölle, die poulärkulturell ja längst mit allen gefüllt ist, die wir nicht mögen. In der Hölle, so könnte man Sartre abwandeln, sind immer die anderen. Wir aber, die wir so urteilen, kommen natürlich alle, alle in den Himmel, dafür sorgt schon Willy Millowitsch. Oh sancta simplicitas! rief Jan Hus angesichts der frommen alten Frau, die das Feuer zu seinen Füßen noch anfeuern wollte. Das hätte der Kleinbürger Kohler gerne, dass wir hier auf Erden gleich an Gottes Stelle und lange vor dem Jüngsten Gericht entscheiden, wer in den Himmel kommt und wer in die Hölle. Das aber, nach allem was wir (zumindest als Christen) wissen und glauben, entscheidet allein noch der Weltenrichter und nicht der Herausgeber der FAZ oder Kanzler Scholz. Wir wissen schlicht nicht, wie Gott am Ende der Zeiten urteilt. Ist er ein Allversöhner wie manche veritablen Theologen vermuten? Oder lässt er die Übeltäter am Ende der Tage einfach in der Erde liegen? Oder wägt er sorgfältig gemäß seinem ewigen Ratschluss die Seelen der Verstorbenen und erweist sich als Vollzieher der Prädestinationslehre (eventuell auch in der doppelten Gestalt). Wir wissen es nicht. Solche Urteile und Gedanken hängen nicht zuletzt davon ab, welcher Religion wir selbst angehören. Wäre Prigoschin Buddhist, würde er also vermutlich als ziemlich mickrige Figur wiedergeboren werden, weil er für so viel Leid und Tod auf Erden verantwortlich war. War er Jude, der vom christlichen Weltgericht wenig gehalten haben dürfte und deshalb im Reich des Todes verharrt? War er orthodoxer Christ, der dann wohl an die Hölle geglaubt hat, die freilich nicht direkt nach dem Tod und ohne göttlichen Gerichtsprozess verordnet wird. Allerdings wäre die Hölle dann kein konkreter Ort, sondern eine spezifische verzehrende Erfahrung Gottes. War er Atheist, dann dürfte ihm das Nachleben recht egal sein, er geht über in einen Zustand, der vor allem aus Wasser, Kohlenstoffdioxid, Harnstoff und Phosphat besteht. Wäre er Protestant, bestünde aufgrund der Rechtfertigungslehre die Hoffnung, dass Gott ihn in den Himmel aufnimmt (dort hatte ihn ja schon die taz landen lassen – aber nur wegen der Überfüllung der Hölle).
Die letzten Dinge sind selbst nach christlicher Lehre sehr komplex. Wer ist schon jetzt im Himmel und für wen bestehen begründete Hoffnungen? Es gibt eine beeindruckende Elfenbeintafel aus dem 11. Jahrhundert, die uns visuell sehr schön über den Himmel und dessen Zugänglichkeit Auskunft gibt. Auch dabei ist manches deutungsbedürftig, in der Sache selbst ist die Tafel aber recht klar: im Paradies des Himmels sind bisher nur wenige Menschen: Abraham und der arme Bettler Lazarus, wegen des Gleichnisses, das Jesus erzählt hat, Dismas, weil Jesus ihm das bei der Kreuzigung zugesagt hat und schließlich Maria, weil die katholische Kirche das so beschlossen hat. Alle anderen müssen warten, „der Cherub steht noch dafür“. Ob die Jünger Jesu schon im Paradies des Himmels sind, wird dagegen nicht so ganz klar, sie sitzen aber direkt neben dem richtenden Christus.

Elfenbeintafel 11. Jahrhundert, Jüngstes Gericht, 15×21 cm, byzantinisch, Victoria & Albert Museum, London
Auch hier sitzen mehr Menschen in der Hölle als auf das Paradies warten. Dabei wissen wir wenig über die Höllenbewohner. Zumindest der reiche Prasser wird von Jesus erzählerisch dort verordnet. Die anderen warten aber nur im Reuch des Todes.
Unter den Theologen des 19. und 20. Jahrhunderts haben viele die Lehre der ewigen Höllenstrafe abgelehnt, u.a. Herman Schell, Hans Urs von Balthasar, Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, Ernst F. Ströter, Karl Barth und Wilhelm Michaelis. Jürgen Moltmann schreibt in seiner „Theologie der Hoffnung“:
„Die Logik der Hölle scheint mir nicht nur inhuman, sondern extrem atheistisch zu sein: hier der Mensch in seiner freien Entscheidung für Hölle oder Himmel – dort Gott als der Ausführende, der diesen Willen vollstreckt. Gott wird zum Diener des Menschen degradiert. Wenn ich mich für die Hölle entscheide, muss Gott mich dort hinstecken, obwohl es nicht sein Wille ist. Drückt sich so die Liebe Gottes aus? Und wo bleibt die Allmacht Gottes? Menschen würden selbst ihrem Schicksal überlassen, sie brauchen Gott eigentlich nicht, denn nur der Mensch bestimmt, was passiert.“
Das ist ja letztlich der (atheistische) Grundgedanke bei denen, die Menschen wie Prigoschin jetzt schon in der Hölle wähnen. Sie brauchen Gott nur noch als Handlanger ihrer eigenen Gerechtigkeitsvorstellungen – ähnlich wie Dante, der seine Gegner und Feinde auch umstandslos in die Hölle beförderte. Weil die Menschen es nicht vermögen, soll Gott dann nach den Vorstellungen der Menschen richten. So funktioniert der Gottesgedanke aber nicht.