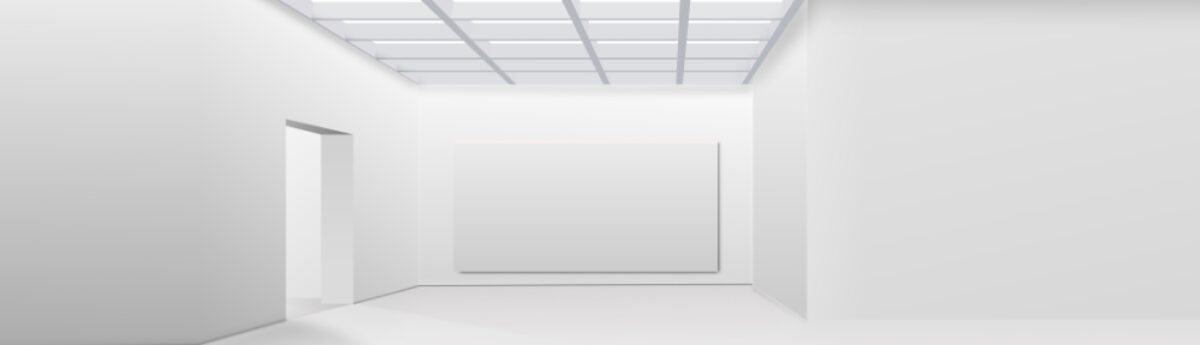Rudolf Bohren („Dass Gott schön werde. Praktische Theologie als Ästhetik“) würde sich zwar im Grabe umdrehen. Dennoch: KIs Predigten schreiben zu lassen, macht innerhalb eines solchen religiösen Systems Sinn, das sich entschieden hat, der Predigt keine kreativen, keine poetische, keine neuen Bedeutungen generierenden Aspekte zuzuerkennen. Wer KI als Predigtgenerator (und nicht nur zur Arbeit an der Predigtsprache) einsetzt, gibt ein homiletisches Urteil über Form und Funktion der Predigt im Gemeindegeschehen ab, er begreift sie als Gebrauchstext.
Denn auch der Hinweis darauf, dass in der kirchlichen Praxis Predigten doch selten Kunstcharakter oder bestimmte poetologische Standards erreichen, geschieht ja in der Absicht, Predigten künftig als Gebrauchstexte zu qualifizieren. Aktuell halten wir jedoch an der regulativen Idee fest, dass Predigten mehr als bloß Werbetexte oder Gebrauchsanweisungen sind und seelsorgerliche Gespräche mehr als ein Anruf im Callcenter. Und auch Gottesdienste sind – bei aller durchaus rationalen Konstruktion der Liturgie – mehr als Verkaufsveranstaltungen. Wenn man an diesem Mehrwert zweifelt, wenn man Gottesdienste für überschätzt und Predigten als schlichte Textgattung der Wiederholung religiöser Texte in anderen Worten ansieht, dann sind freilich KI-gesteuerte autonome Systeme denkbar, die das personen-zentrierte religiöse System ablösen können (und sollten).
Die Debatten um den angeblichen von einer Künstlichen Intelligenz generierten Gottesdienst auf dem Ev. Kirchentag in Nürnberg (der in Wirklichkeit nur mit Hilfe von ChatGPT zustande kam und von einem theologischen Subjekt namens Jonas Simmerlein authentifiziert wurde und damit eben kein autonomes, künstlich-intelligentes und künstlerisches Geschehen darstellt), kreisen also um die Frage, ob wir in den christlichen Gemeinden zu einer sozialen Vereinbarung kommen können, wollen bzw. werden, welche die von der KI generierten Predigten als genuin religiöse Texte anerkennt, nicht zuletzt, weil sie die Wandlung der Predigt vom poetischen Text zum Gebrauchstext vorantreibt. Ein (noch kleiner) Teil der theologischen und kirchlichen Welt scheint dazu zu neigen.
Aber die Frage ist nicht einmal ansatzweise entschieden. Wie bei der Kunst bestimmen darüber ja nicht ein paar technologie-animistisch Denkende, sondern die soziale Gruppe, in diesem Fall die religiöse Gemeinschaft. So wie ich die Mehrzahl der heutigen Gemeinden einschätze, haben sie nichts dagegen, dass ihre Prediger:innen mit ChatGPT zur Vorbereitung der Predigt experimentieren. Das machen auch Künstler.innen und Schriftsteller:innen mit ihren Artefakten. Es dürfte aber kaum Common Sense sein (und wohl auch nicht werden), dass die Predigenden durch Algorithmen ersetzt werden oder auch nur ersetzt werden könnten.
Der soziale Prozess, der Predigen von einem poetischen Vorgang zu einem Gebrauchstexte produzierenden Vorgang umwerten könnte, ist jedoch kein voluntaristischer Akt, bei dem ein paar akademische Theolog:innen nun entscheiden könnten, künftig auf menschliche Predigende zu verzichten. Es gibt auch keine dafür legitimierte Kirchenleitung, die einfach entscheiden könnte, dass Predigten eigentlich nur Werbetexte für die Kirche seien und daher Predigende als Werbetreibende auch ebenso gut durch Algorithmen ersetzt werden könnten. Manche meinen, wenn man zeigen könne, dass Maschinen genauso gut predigen können wie Menschen (im Sinne des Wirkungsäquivalents), dann würde das Pendel zugunsten der Maschinen ausschlagen. Aber sie missverstehen, was eine soziale Vereinbarung ist.
Mit Karl Barth (KD IV/3, S. 995f.) lässt sich die essentielle Aufgabe und Funktion der Predigt zunächst dahingehend zusammenfassen,
„dass die Gemeinde sich (und so auch die mithörende Welt) in ihr ausdrücklich an das ihr aufgetragene Zeugnis erinnert, erinnern lässt, sich seines Inhalts aufs neue vergewissert, in seinem Reflex Jesus Christus selbst aufs neue zu sich reden, sich aufs neue zu seinem Dienst in die Welt aufrufen lässt.“ Dabei ist die Predigt zugleich auch „selbständig vollzogene Aussage und Erklärung des Evangeliums, selbständig gewagter evangelischer Anruf.“
Diesen Kriterien genügt eine KI-generierte Predigt sozusagen a priori nicht. Wer anderes behauptet, denkt in Modellen von Generika, wonach die Predigt ein Wirkstoff ist, der nachgebaut werden kann. Im kulturellen Sektor entspricht genau das aber magischem Denken.
Ein Generikum oder Nachahmerpräparat ist ein Arzneimittel, das wirkstoffmäßig mit einem bereits früher zugelassenen Arzneimittel übereinstimmt. Von dem Originalpräparat kann sich das Generikum bezüglich enthaltener Hilfsstoffe und Herstellungstechnologie unterscheiden. Es unterliegt einer vereinfachten Zulassung, bei der auf Unterlagen des Originalpräparats zurückgegriffen wird … Ein Generikum soll dem Originalprodukt in dessen beanspruchten Indikationen therapeutisch äquivalent sein, d. h., es muss ihm in Wirksamkeit und Sicherheit entsprechen.
Wenn also technologisch generierte Texte sich quasi als wirkungsäquivalent zu den bisherigen Predigten erweisen, schließt man daraus, dass sie die (aufwendigeren) Ursprungstexte (also die menschlichen Predigten) ersetzen können. Exakt das ist das Modell der Generika. Und man muss überlegen, ob man sich diesem Modell anschließen will, auch wenn man es nun auf kulturelle Phänomene anwendet (Kulturwissenschaft wie Naturwissenschaft versteht). Es ist das alte mittelalterliche Modell, bei dem man Kranke erst vor den Isenheimer Altar schleppte, und erst wenn Heilung sich nicht einstellte, zum Arzt wechselte. Das war dingmagisches Denken – und das Ergebnis im Verlauf der Geschichte kennen wir. Heute gehen wir lieber gleich zum Arzt. Predigten sind eher im Sinn von poetischen Texten und der Interpretation poetischer Texte zu verstehen. Und daran sollten wir festhalten.