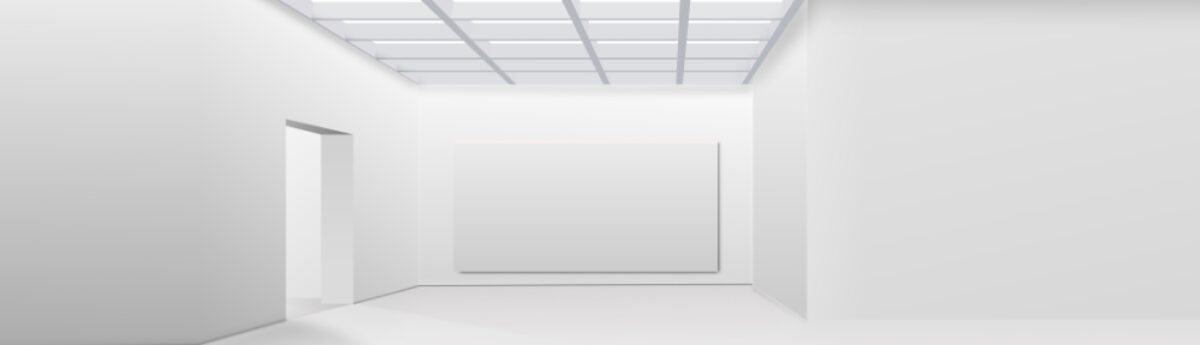Im Augenblick wird meine Kritik an der Predigt des Schlussgottesdienstes beim Kirchentag in Nürnberg auf Facebook kritisch gewürdigt. Das ist das Schöne in einer meinungs-differenten Welt, dass nicht immer nur ein Prediger recht hat oder sein Kritiker, sondern dass es ganz unterschiedliche Perspektiven auf kontroverse Sachverhalte gibt. Insofern ist jede Diskussion nur zu begrüßen.
Gut, bestimmte Standards sollten bei diesen Diskussionen eingehalten werden, man sollte vor allem nicht ad hominem argumentieren und man sollte dem anderen nicht Dinge unterstellen, die für ihn nicht zutreffen.
Nein, ich bin kein ordinierter Pfarrer, der einen Kollegen kritisiert, ich bin ein ganz normales Gemeindeglied (mit theologischer Ausbildung), der seine Perspektive auf eine öffentliche und medial bundesweit verbreitete Predigt artikuliert.
Nein, ich hasse den Kirchentag nicht, ganz im Gegenteil, wer meine Texte im Magazin für Theologie und Ästhetik in den letzten 25 Jahren verfolgt, weiß, dass ich mich immer wieder auf die großen Projekte und Leistungen des Kirchentages, wie etwa die Begleitung der Bibel in gerechter Sprache, die Förderung des christlich-jüdischen Gespräches beziehe, ja dass ich selbst diverse Projekte und Texte zum Kirchentag beigesteuert habe. Ich muss da also nichts abarbeiten, wie mir einige Stammtischpsychologen unterstellen.
Nein, ich vergleiche den Kirchentag auch nicht mit einem totalitären System, ich verweise nur darauf, dass ein befreundeter Autor, 1935 geboren, die Massenorientierung des Kirchentages mit seinen Kindheitserfahrungen verglich. Ich kritisiere den Kirchentag, weil er die Solidarität, die wir als evangelische Christ:innen den Künstler:innen nach 1945 schulden (vgl. dazu Hans Prolingheuer: Hitlers fromme Bilderstürmer. Kirche & Kunst unterm Hakenkreuz. Berlin 2001), an entscheidender Stelle gebrochen hat, weil man den Herrschenden und Kirchenfürsten eines anderen Staates mit der Ausladung Herta Müllers gefällig sein wollte.
Nein, ich bin auch nicht genderkritisch, sondern genderkritik-kritisch (z.B. hier, hier, hier). Aber dazu müsste man sich informieren und im Magazin tà katoptrizómena lesen. Aber diese Zeit haben wir heute nicht mehr, wo einigen schon eine 20-Seiten-Lektüre als Zumutung vorkommt.
Dass der Titel dieses Magazins tà katoptrizómena lautet, ist kein Beitrag zur Spaßgesellschaft, es ist keinesfalls lustig gemeint, sondern greift Formulierungen des Apostels Paulus im 1. und 2. Korintherbrief auf, die über unser grundsätzliches Verhältnis zur Welt Auskunft geben.
ἡμεῖς δὲ πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν κυρίου κατοπτριζόμενοι τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν καθάπερ ἀπὸ κυρίου πνεύματος.
Ob diese Formulierung popkulturell tauglich ist, könnte man etwa anhand von Justin Timberlakes Video zu „Mirrors“ (2013) nachprüfen.
Grundsätzlich aber sollten wir uns in der Kirche der Gegenwart darüber verständigen, was Kritik bedeutet und was der Kirche Kritik wert ist. Wer sich kritisch zur Kirche verhält, so musste ich erfahren, gilt wie Jorge von Burgos als übellaunig. Ich würde frei nach Adorno dagegenhalten:
„Der Splitter in meinem Auge ist vielleicht das beste Vergrößerungsglas“.
In meinem Text zur Kirchentagspredigt gab es zwei marginale Fehler, die ich inzwischen korrigiert habe. So habe ich geschrieben, die Lutherbibel habe das Wort „töten“ durch „sterben“ ersetzt. Das ist unzutreffend, es war der Kirchentagsgottesdienst selbst, der an dieser Stelle vom Luthertext abgewichen ist und von „sterben“ sprach. Im Gottesdienst ist das auch auffällig, weil zweimal kurz hintereinander von „sterben“ die Rede ist. Dort hieß es „Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit; pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit; sterben hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit“. Das ist für die durchdachte Poetik des Kohelet ungewöhnlich. Ansonsten gab es einen sinnentstellenden Rechtschreibfehler, ein P fehlte in meinem Text.
Um ein wenig zur sachlichen Diskussion beizusteuern, möchte ich etwas nachtragen, was meine Gedanken zur Predigt auf dem Kirchentag inhaltlich bestimmt hat, im Text aber nicht explizit ausgeführt wurde – wohl aber der Sache nach. Es sind Zitate aus einem Vortrag über die ‚Gemeindemäßigkeit der Predigt‘, gehalten in der schon bedrängten Zeit des Jahrs 1935:
Der Prediger kann unmöglich seinen Mund legitim auch nur auftun als christlicher Prediger, ohne zum vornherein den Bogen des Bundes geschlagen zu sehen über die, mit denen er es zu tun hat, ohne bei jedem Wort, das er sagt, zu bedenken, dass Christus für diese Menschen gestorben und auferstanden ist, dass Gott sich dieser Menschen schon erbarmt hat und dass er darum, weil er sich ihrer erbarmt hat, sich ihrer auch annehmen wird in Zeit und Ewigkeit. Das ist sozusagen die objektive, die „sakramentale“, die „metaphysische“ Voraussetzung der Predigt, ohne welche sie nicht bestehen kann.
Die Gottesdienstgemeinde ist als Gemeinde keine Menschengruppe, die ideologisch oder politisch zu belehren ist oder über die der Prediger Gericht zu halten hat. Die Gottesdienstgemeinde ist eine über die sich Gott schon erbarmt hat. Das sollte man immer bedenken. Natürlich ist diese Gottesdienstgemeinde auch eine fehlerhafte und sündige Gemeinde, aber was heißt das für den ebenfalls fehlerhaften und sündigen Prediger? Gibt ihm das eine besondere Stellung, das Recht, die Gemeinde mit seinen Wahrheiten zu belehren?
Was kann unter diesem Gesichtspunkt Dienst am Wort Gottes bedeuten, dass da eine Gemeinde ist, Ausgesonderte, aber eine Gemeinde von Menschen, Sündern, Sterbenden? Dienst am Wort Gottes: darin liegt eine Abgrenzung gegenüber allen anderen an sich auch möglichen und weithin auch guten und verheißungsvollen Versuchen menschlicher Rede. Wenn die Predigt Dienst am Wort Gottes ist, dann kann der Versuch, der da gemacht wird, der Dienst, der da in Angriff genommen wird, Menschen das Evangelium zu sagen, unter keinen Umständen darin bestehen wollen, wie es sonst wohl auf der ganzen Linie der Fall ist, wo Menschen miteinander reden, dass der Prediger seinen Hörern ein kleineres oder größeres Wahrheitssystem vermittelt. Wenn wir Menschen sonst miteinander reden, dann geht es uns wohl immer darum, uns gegenseitig ein Bild zu vermitteln von einer Wahrheit, die uns vorschwebt, ein Bild von kleinen Erfahrungen und Erkenntnissen, für die man die anderen gewinnen möchte. Dieses Vorgehen kann nicht das Vorgehen des christlichen Predigers sein. Wo der Prediger meint, über ein Wahrheitssystem zu verfügen, da sündigt er gegen das Gebot der Gemeindemäßigkeit. Denn dazu ist er nicht unter diese Menschen gestellt, um das zu tun, was nun eben ein Philosoph, ein Politiker, ein Pädagoge zu tun pflegt. Dienst am Wort Gottes muss nach der Heiligen Schrift heißen: Bezeugung des in seinem Wort und in seinem Handeln offenbaren Gottes selber. … Die Predigt hat die Aufgabe, die Texte des Alten und des Neuen Testamentes heute in der heutigen Sprache heutigen Menschen zu vermitteln.
Exakt das, was Karl Barth hier 1935 in seinem Vortrag zur Gemeindemäßigkeit der Predigt gesagt hat, habe ich bei der Kirchentagspredigt in Nürnberg verletzt gesehen – und zwar elementar. Hier wurde nicht das Wort Gottes bezeugt, wie es sich in der Heiligen Schrift (hebräische Bibel und neutestamentliche Deutung) zeigt, sondern ein Wahrheitssystem der sich angeblich im Stand der Lüge befindlichen Gemeinde übergestülpt.
Und das dritte, was ich nicht eingelöst sah, war die Liebe zu jener Gemeinde, die vor dem Prediger und vor den Bildschirmen saß. Von ihnen hatte sich der Prediger ein Bild gemacht, gegen das er nun predigte. Dagegen sei mit Max Frisch gesprochen:
„Du bist nicht“, sagt der Enttäuschte oder die Enttäuschte: „wofür ich Dich gehalten habe.“ Und wofür hat man sich denn gehalten? Für ein Geheimnis, das der Mensch ja immerhin ist, ein erregendes Rätsel, das auszuhalten wir müde geworden sind. Man macht sich ein Bildnis. Das ist das Lieblose, der Verrat.
Und Liebe heißt eben nicht, die anderen erziehen zu wollen, sondern sie anzunehmen wie sie sind. Abschließend deshalb noch einmal Karl Barth:
Die Voraussetzung der Predigt muss ganz schlicht die Liebe des Predigers zu der Gemeinde sein. Liebe, das heißt ganz schlicht: Nicht ohne diesen anderen, den man liebt, sein wollen, nicht allein sein wollen, sondern mit ihm sein wollen, wie er nun einmal ist, in seiner Totalität, in seiner Wirklichkeit. Die Wirklichkeit der Gemeinde, das ist die Wirklichkeit der Kinder Gottes im finsteren Tal. Wenn ich diesen Menschen das Wort Gottes sagen will, so muss ich diese Menschen lieb haben, mit ihnen sein wollen, wie sie sind.