Ich lese gerade Angela Rinns Klage auf z(w)eitzeichen darüber, dass der Wert der Bücher in Zeiten der Digitalität zu sinken scheint: „Leibhaftiges Gedächtnis. Über den Wert von Büchern und Bibliotheken in der digitalisierten Welt“. Sie hat an einem Buch über Gedächtnis mitgearbeitet und fragt, welche Halbwertszeit dieses Buch wohl hat, wenn man überlegt, dass immer mehr Menschen nur noch auf das zugreifen, was digital zugänglich ist.
Als Autor kann ich diese Klage gut nachvollziehen. Das publizierte Buch ist ein Fetisch im eigenen Leben. Ich habe einen Schrank, der nur den von mir publizierten Texten in Büchern und Zeitschriften vorbehalten ist und dieser Schrank ist ganz programmatisch ein Bücherschrank, den ich von meinem Großvater übernommen und nun mit eigenen Elaboraten gefüllt habe. Diese Bücher (und dieser Schrank) haben einen elementaren Wert – für mich.
Dennoch übereigne ich Monat für Monat einen halben Regalmeter meiner sonstigen Bibliothek dem Altpapiercontainer, schlicht deshalb, weil die Bücher für den Augenblick geschrieben waren und deshalb überholt sind, weil sie auf kein Interesse bei Antiquariaten stoßen oder aus Themengebieten stammen, die mich temporär vor Jahren einmal interessiert haben und heute und auch künftig nicht mehr. Andere Bücher habe ich inzwischen digitalisiert zur Hand und kann wesentlich besser damit arbeiten, als wie in früheren Zeiten mich durch die Seiten zu quälen.
Ich bin also kein Buch-Fetischist – mit einer Ausnahme: die Andere Bibliothek von Hans Magnus Enzensberger, von der ich über 300 Bände besitze, ist tatsächlich ein Buch-Fetisch für mich. Aber nicht wegen etwaiger Inhalte (so spannend sie auch sind), sondern weil ein Großteil von ihnen noch mit Bleisatz gedruckt wurde. Und wenn man schon von Büchern schwärmt, dann doch bitte von diesen. Wo die Fingerkuppen noch den einzelnen Buchstaben folgen können, wo Lesen noch dreidimensional erfolgt und nicht wie im Computersatz sich im Zweidimensionalen erschöpft. Diese Bücher – samt all den anderen die ich aus der Zeit zwischen 1700 und 1930 habe, kann ich nicht durch Digitalität ersetzen. Hier geht es weder um Gedächtnis, um Wissen oder Poesie, sondern um Haptik.
Und dennoch bin ich im letzten Vierteljahrhundert – wie all die jungen Leute um mich herum – zu einem Menschen des Digitalen geworden. Das Stöbern in alten Büchern, an die ich nie in meinem Leben gekommen wäre, die nun aber digitalisiert zugänglich geworden sind, war einfach faszinierend (Vom besonderen Vergnügen, alte Texte zu lesen).
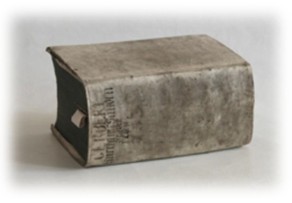
Manchmal kaufe ich mir dann nachträglich ein solch leibhaftes Objekt (oder lasse es mir schenken), einfach weil ich mit den Fingern durch die mit Bleisatz bedruckten Seiten blättern möchte. Um die Argumente zu begreifen würde mir jedoch eine digitale Ausgabe genügen.
Ansonsten habe ich mich für das Digitale entschieden. Ein Grund dafür ist tatsächlich Kohelet 12, 12: Zu guter Letzt, meine Schülerin, mein Schüler, lass dich warnen: Das viele Büchermachen findet kein Ende, und viel Studieren ermüdet den Leib. Die Fülle der Bücher nimmt einfach nicht ab, sondern steigert sich von Jahr zu Jahr. Und die wenigsten Bücher lese ich noch von Anfang bis Ende. Da ist es viel besser, sie digital zur Verfügung zu haben, sie auf Stichworte durchforsten zu können und Zitate per Cut & Paste in die eigene Arbeit aufzunehmen.
Leibhaft – um das Stichwort von Angela Rinn aufzugreifen – sind mir nur noch bibliophile Bücher wichtig, Bücher, die mit einem offenen Rücken gebunden sind, Bücher und Hefte, die in Kleinstauflagen gedruckt sind, Bücher und Hefte, die mit Originalgrafiken versehen sind. Das lässt sich nicht digitalisieren. Ich habe mir gerade im Zürcher Antiquariat eine Ausgabe von Spektrum – internationale Vierteljahresschrift für Dichtung und Originalgrafik Zürich gekauft. Sie besteht exklusiv aus Lyrik und originalen Grafiken. So etwas zu publizieren ist heute undenkbar oder unbezahlbar. Und es ist ein Vergnügen, das Heft überhaupt nur hier auf dem Schreibtisch liegen zu sehen und ab und an darin zu blättern.
Und dennoch. Wer Bücher und Bibliotheken sagt, muss als literarisch Kundiger natürlich sofort an „Die Bibliothek von Babel“ von Jorge Luis Borges denken, 1941 geschrieben. Ein Lobpreis der Bücher (auch der scheinbar sinnlosen) und zugleich voller Weitsicht und Einsicht. An einer Stelle seiner Erzählung gibt es aber eine Fußnote und die lautet so:
„Letizia Alvarez de Toledo hat angemerkt, dass die ungeheure Bibliothek überflüssig ist; strenggenommen würde ein einziger Band gewöhnlichen Formats, gedruckt in Corpus neun oder zehn, genügen, wenn er aus einer unendlichen Zahl unendlich dünner Blätter bestünde. (Cavalieri sagte zu Anfang des Jahrhunderts, dass jeder feste Körper die Überlagerung einer unendlichen Zahl von Flächen ist.) Die Handhabung dieses seidendünnen Vademecums wäre nicht leicht; jedes anscheinende Einzelblatt würde sich in andere gleichgeartete teilen; das unbegreifliche Blatt in der Mitte hätte keine Rückseite.“
Ich frage mich, ist das Internet, sind die digitalen Welten nicht genau das: ein einziger Band be-stehend aus einer unendlichen Zahl unendlich dünner Blätter, gefüllt mit einer unendlichen Zahl von Texten, von denen ein Großteil unverständlich bleibt, dem man aber immer wieder neue Textfragmente entringen kann? Ob dieses eine Buch, die digitale Bibliothek von Babel noch eine Mitte hätte, wäre demgegenüber sekundär. Es wäre nur eine metaphysische Spekulation.
Als ich mich mit Freunden und Freundinnen vor 28 Jahren entschied, die Zeitschrift tà katoptrizómena nicht als gedruckte Zeitschrift zu konzipieren, sondern als digitale, da standen mir all diese Debatten um den Schatz und Nutzen der gedruckten Bücher vor Augen. Ich war mir aber auch im Klaren darüber, dass – wenn es um die Idee des geteilten Wissens geht – Bücher immer auch der Distinktion dienten. Digitalität kann das unterlaufen – muss es aber nicht. Open Access ist mit Printbüchern nur bedingt möglich – im Internet aber leichter zu realisieren. Sollte einmal eine Neutronenbombe das digital gespeicherte Wissen auf einen Schlag vernichten, dann wäre es, als hätte es nie existiert. Dieses apokalyptische Restrisiko muss ich eingehen.
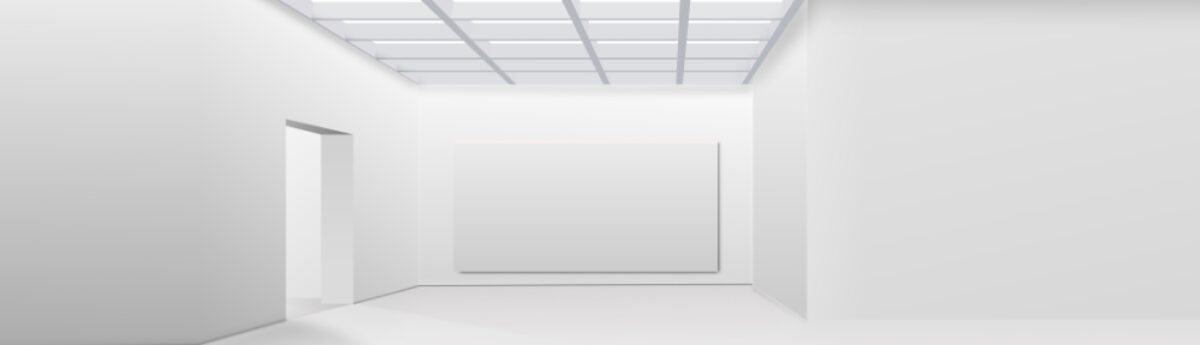

Ein Gedanke zu „Prediger 12, 12 oder die Bibliothek zu Babel“
Die Kommentare sind geschlossen.