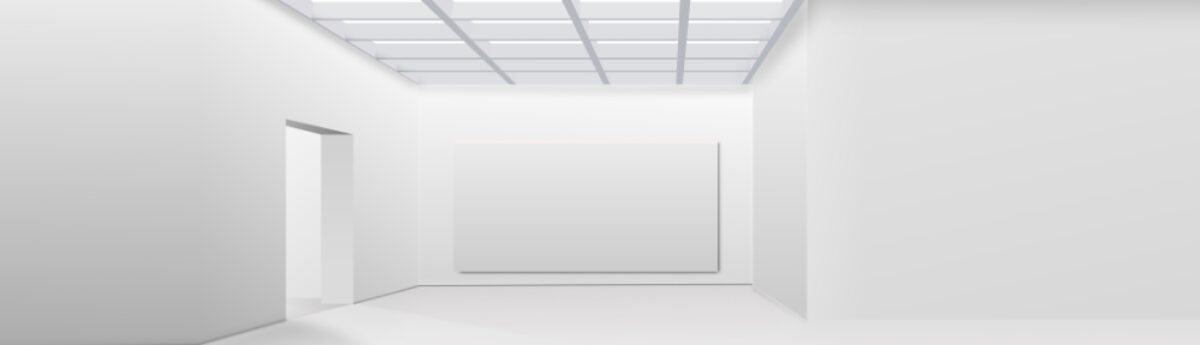In ihrem im vorherigen Post angesprochenen Text klagt Angela Rinn darüber, dass bei einem Lagerbrand ein guter Teil ihrer Buchauflage bei der EVA verbrannt sei und wohl auch nicht mehr aufgelegt würde. Das brachte mich dazu, einmal bei der Deutschen Nationalbibliothek nachzuschlagen, welche ihrer Bücher denn heute schon digital zugänglich sind und daher den Flammen weitgehend unzugänglich. Und siehe da, es sind nicht wenige. Die Deutsche Nationalbibliothek hat ja bei den Buchmeldungen die Rubrik „Andere Auflagen“ und da wird verzeichnet, wie es um Digitalisierungen steht.
Der andere Weg wäre natürlich in den berühmten Schattenbibliotheken des Internets zu stöbern, ob jemand nicht Werke von Angela Rinn gescannt und so (illegalerweise) der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt und damit ihr Wissen geteilt hat. Auch wenn die deutschen Netzbetreiber das zu unterbinden suchen (im Augenblick meldet der Provider beim Aufruf der Library Genesis immer aufgrund einer in Deutschland geltenden DNS-Sperre „Seite wurde nicht gefunden“), so funktioniert das dennoch ohne größere Umwege und man wird auch fündig (17 Download-Angebote), wenn auch nicht mit ihren Werken bei der EVA. Aber auch so bleibt Literatur erhalten und geht nicht unter. Raubkopien nannte man das in den 68er-Jahren und es war durchaus üblich.
Nachzutragen wäre zudem, dass die bürgerliche Klage vom Verlust des Buches zu vergleichen wäre mit Platons Klage über den Verlust der Oralität durch die Hinwendung zur Schriftlichkeit. Platon meinte, „Geschriebenes sei nicht zur Wissensvermittlung geeignet, sondern nur als Gedächtnisstütze nützlich, wenn man den Inhalt bereits verstanden hat. Das Schreiben sei nur ein mangelhaftes Abbild des Redens. Der geschriebene Text scheine zu sprechen, aber in Wirklichkeit ‚schweige‘ er, denn er könne weder Verständnisfragen beantworten noch sich gegen unberechtigte Kritik zur Wehr setzen. Auf die individuellen Bedürfnisse des Lesers könne er nicht wie ein Gesprächspartner eingehen. Weisheit lasse sich daher auf diesem Wege nicht vermitteln“ (Zusammenfassung nach der Wikipedia). Soweit zum Nach(zu)tragenden.
Nun aber zum Tröstlichen: Angela Rinn sorgt sich um den Nachruhm, den Schreibende und Publizierende ja anstreben und der verloren gehe, wenn niemand mehr ihre Bücher lese. Ja, das ist so. Man bleibt heute als Massenmörder länger im Gedächtnis als fast jeder Autor. Aber das hat auch etwas Tröstliches, wenn wir an eine der für mich schönsten Geschichten von Arno Schmidt denken. Fasziniert hat mich die Erzählung zunächst in Zeiten, in denen ich selbst noch gar nicht oder doch nur wenig publizierte. Mit der Zeit wurde meine Haltung ambivalenter, denn nun gehörte ich ja auch zu den Publizisten, die von der geschilderten Handlung in der Erzählung betroffen waren. Kenner:innen werden wissen was ich meine: Tina oder über die Unsterblichkeit.
Nicht nur Homer kannte sich aus mit der Unterwelt. Auch Arno Schmidt, knapp 3000 Jah-re später, hat seinen Lesern zu einem Blick ins Jenseitige verholfen. Sein Elysium liegt geradewegs unter Darmstadt, und wie bei Homer im Hades wollen auch die Seelen in Schmidts Erzählung, allesamt mehr oder weniger bekannte Dichter, nichts wie weg. Lei-der steht dieser Sehnsucht der im Diesseits so hartnäckig angestrebte Ruhm im Weg. Denn es gilt die Regel: »Jeder ist so lange zum Leben hier unten verdammt, wie sein Name noch akustisch oder optisch auf Erden oben erscheint.« Der Maler und Graphiker Eberhard Schlotter hat die so witzige wie bitterböse Satire auf den Dichter-traum von der Unsterblichkeit mit 25 Radierungen illustriert. Und Text wie Bild lassen keinen Zweifel: Nicht die Unsterblichkeit kann das Ziel sein, sondern das gnädige Vergessen: »endlich in Ruhe tot sein«!
Soweit der Klappentext des Buches. [Nicht verschwiegen werden sollte an dieser Stelle, dass es von Arno Schmidt eine Gegengeschichte mit Goethe gibt, aber die lasse ich einfach mal beiseite.] Es kommt mithin auf die Perspektive an. Wenn man so lange in den Limbo verdammt ist, wie noch eine einzige Zeile aus Publikationszeiten bekannt ist, dann ist es vielleicht besser, die Buchkultur nicht allzu sehr zu schätzen und zu pflegen, denn dann verlängert man automatisch den Aufenthalt im Purgatorium (das übrigens durch einen Aufzug in einer Litfaßsäule in Darmstadt zugänglich sein soll).
Ein Bücherbrand auf Erden löst in diesem Purgatorium immer einen Freudentaumel aus. Endlich wieder ein paar Dichter-Seelen frei, endlich wieder ein paar Bücher weniger, endlich Hoffnung auf ein anderes Leben. Eine Doktorarbeit über die Biografie oder das Werk von Autor:innen löst dagegen im Gegenzug Entsetzen und Verzweiflung aus. Schon wieder Hunderte von Universitätsbibliotheken, die das in ihre Archive aufnehmen müssen und dem Vergessen entgegenwirken. Es ist sozusagen das auf den Kopf gestellte „Publish or perish“: Publish and perish! Wenn das all unsere Nachwuchs-Wissenschaftler:innen wüssten, denen nichts wichtiger ist, als durch eine Vielzahl von peer-reviewten Texten zu glänzen. Aber die lesen vermutlich auch keine Texte von Arno Schmidt, sondern schreiben fleißig weiter ihre Bücher und Aufsätze und verlängern so den Aufenthalt im Purgatorium.
Der Ruhm, so meine ich jedenfalls, sollte der dargestellten Sache, der Erkenntnis, dem prophetischen Satz selbst zukommen – nicht unbedingt dem Urheber als solchem. Das scheint mir ein Überbleibsel des Geniekults zu sein. Aktuell wäre ein Beispiel dafür jene Bischöfin, die etwas menschlich ganz Selbstverständliches in einem Gottesdienst sagt. Und plötzlich geht es nur noch um die Person als Heldin oder Prophetin im Gegenüber zu einer anderen Person und nicht um die Auseinandersetzung mit der Theologie des von ihr Ausgeführten. In Deutschland wäre jetzt über die Zwei-Reiche-Lehre und über Barmen V zu sprechen und kein Personenkult zu betreiben – auch wenn ich mich natürlich auch über ihre Intervention gefreut habe.